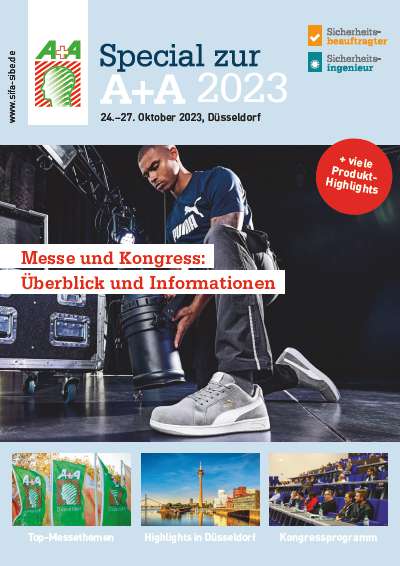Der vorliegende Artikel beschreibt die Konsequenzen einer weitgehend personenzentrierten Ursachenforschung bei Arbeitsunfällen. Gleichzeitig unterstreicht er die Bedeutung einer systemzentrierten Perspektive für die Schaffung eines effektiven Sicherheits- und Präventionsmanagements im Sinne eines gesundheitsorientierten Unternehmens. Simulationsmodelle spielen hier eine bedeutende Rolle.
Dr. Fabian-Simon Frielitz, Stefan Koch
Unsere Webinar-Empfehlung
22.02.24 | 10:00 Uhr | Das Bewusstsein für die Risiken von Suchtmitteln am Arbeitsplatz wird geschärft, der Umgang mit Suchtmitteln im Betrieb wird reflektiert, sodass eine informierte Entscheidung über Maßnahmen zur Prävention von und Intervention bei Suchtmittelkonsum am Arbeitsplatz…
Teilen:











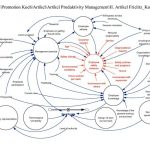

 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!