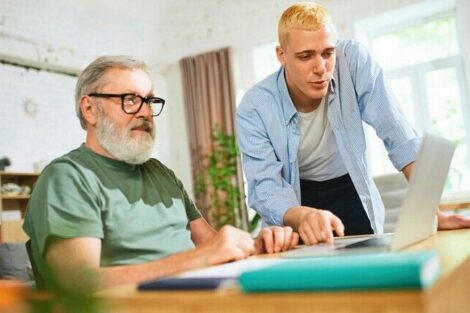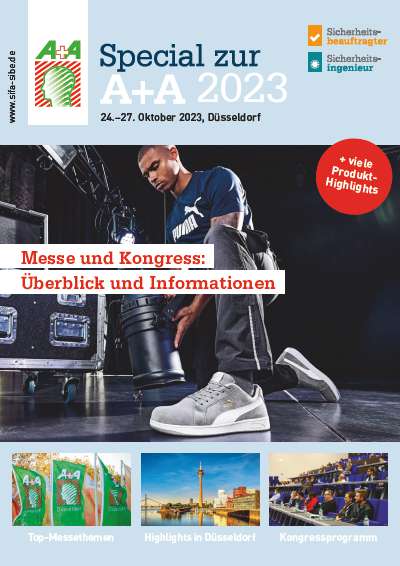Instandhaltung von Geräten, Reparaturen, Reinigungsarbeiten und vielleicht auch mal die Bohrmaschine zur Hand nehmen: Als Allrounder erledigen Hausmeister täglich unterschiedlichste Aufgaben, in Gebäuden genauso wie im Freien. Je nachdem, um welche es sich konkret handelt, benötigen sie spezielle Berufskleidung. Dabei ist genau zu prüfen, wann anstelle normaler Arbeitskleidung eine
Unsere Webinar-Empfehlung
Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…
Teilen:










 SibePlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SibePlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!