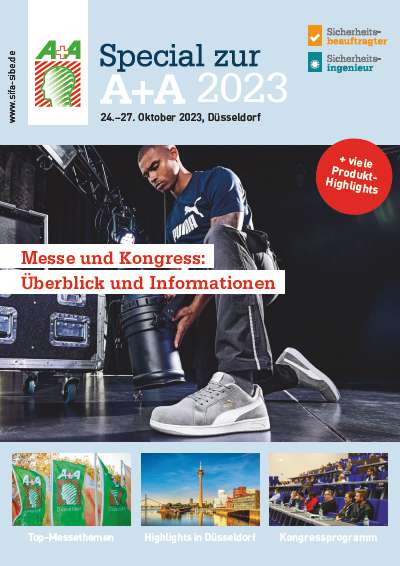In der Gefährdungsbeurteilung müssen seit dem Jahr 2013 explizit auch psychische Belastungen erfasst und beurteilt werden. Das erscheint in vielen Firmen immer noch wie eine Pflichtübung: Zum einen mangelt es am „Gewusst-wie“, zum anderen bestehen Zweifel am Sinn und Nutzen, da psychische Beschwerden oft als individuelle Probleme angesehen werden.
Unsere Webinar-Empfehlung
Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…
Teilen:










 SibePlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SibePlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!