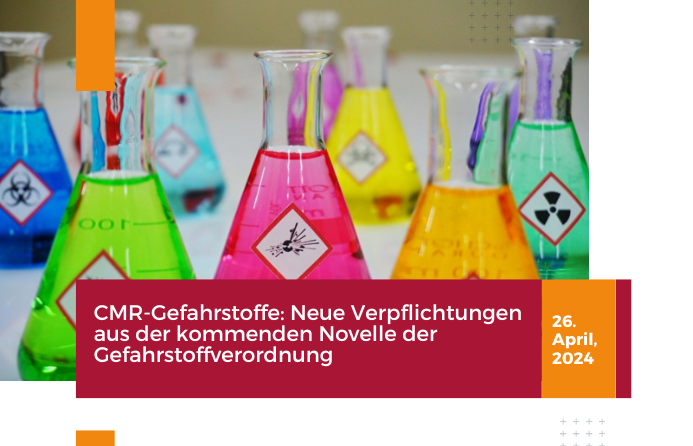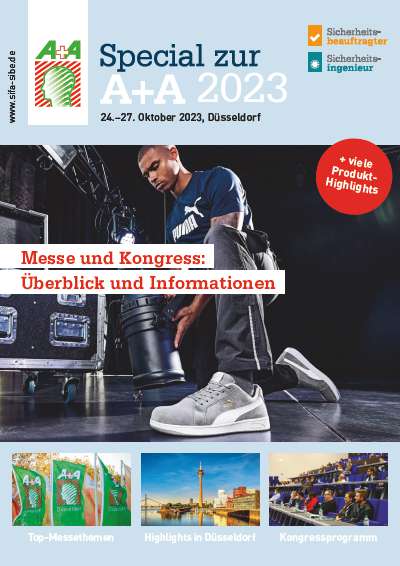Aus der Praxis – auch von Lesern dieser Zeitschrift – wird immer wieder die Frage gestellt, welche Bedeutung die MAK-Werte-Liste der DFG für die Arbeit der Sicherheitsfachkräfte hat, da die in Deutschland gültigen Luftgrenzwerte doch heute in der TRGS 900 „Luftgrenzwerte“ stehen. Der nachfolgende Beitrag erläutert die Hintergründe und
Unsere Webinar-Empfehlung
CMR-Gefahrstoffe der Kat. 1A oder 1B stellen unter den Gefahrstoffen die höchste Gesundheitsgefahr dar, weshalb die Gefahrstoffverordnung in § 10 besondere Schutzmaßnahmen für diese Stoffe vorschreibt.
Teilen:










 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!