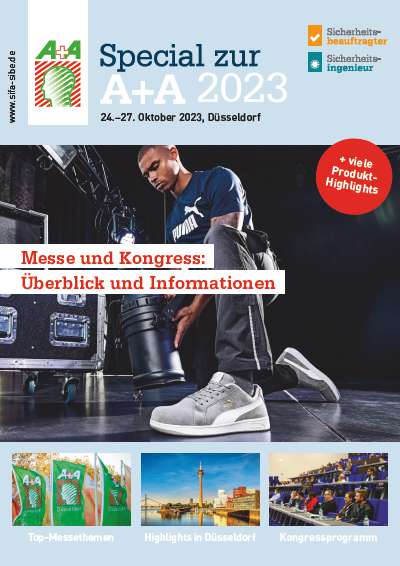Ungesicherte oder nicht ausreichend gesicherte Ladung kann rutschen, sich verschieben und durch die hohe Fliehkraft sogar auf die Fahrbahn oder nachfahrende Fahrzeuge stürzen. Jeder fünfte LKW-Unfall in Deutschland könnte durch ausreichende Ladungssicherung verhindert werden.
Ungesicherte oder falsch gesicherte Ladung ist und bleibt ein unberechenbares Risiko. Laut
Unsere Webinar-Empfehlung
Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…
Teilen:










 SibePlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SibePlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!