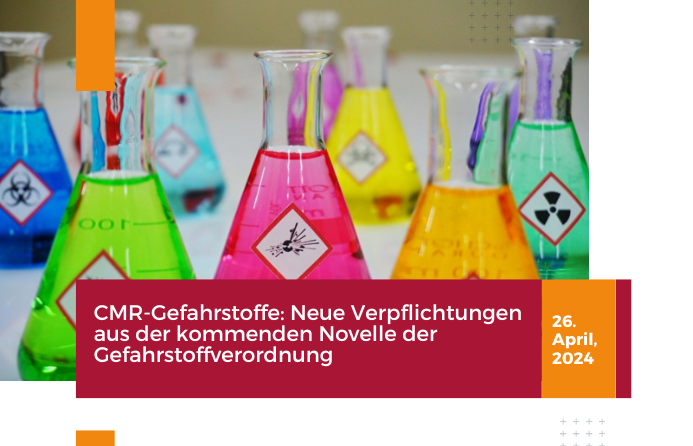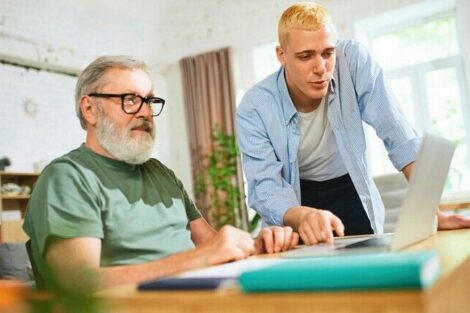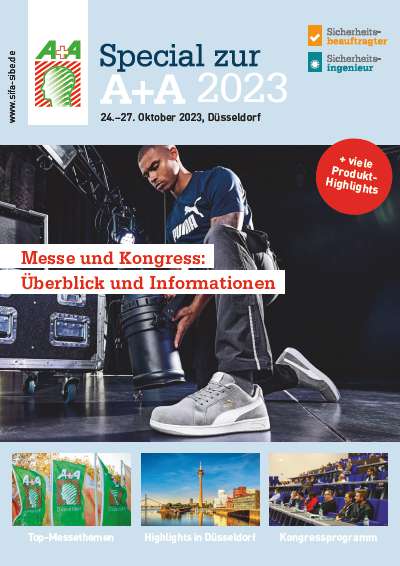Mit der Norm EN 374–3 – inzwischen ersetzt durch EN 16523–1 – wird die Durchdringung von Handschuhmaterialien gemessen. Ergebnisse finden sich in Abschnitt 8.2. von Sicherheitsdatenblättern. Abweichende Bedingungen wie zum Beispiel höhere Anwendungstemperaturen im Vergleich zur Normtemperatur von 23 °C können die Durchdringungszeit von Handschuhen und damit die Schutzwirkung
Unsere Webinar-Empfehlung
CMR-Gefahrstoffe der Kat. 1A oder 1B stellen unter den Gefahrstoffen die höchste Gesundheitsgefahr dar, weshalb die Gefahrstoffverordnung in § 10 besondere Schutzmaßnahmen für diese Stoffe vorschreibt.
Teilen:









 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!