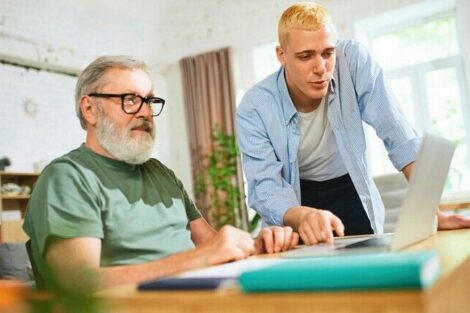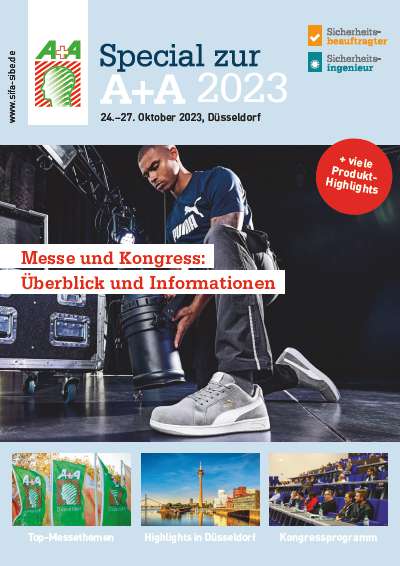Ein seit Ende 2019 in China aufgetretenes Corona-Virus (SARS-CoV‑2), das schwere Atemwegserkrankungen verursacht, wurde erstmals am 27.1.2020 in Deutschland in München identifiziert. Nachdem die ersten Fälle sehr gut einzeln nachverfolgt und isoliert werden konnten, kam es ab Ende Februar zu einer massiven Ausbreitung des Virus in ganz Deutschland.
Unsere Webinar-Empfehlung
Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…
Teilen:










 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!