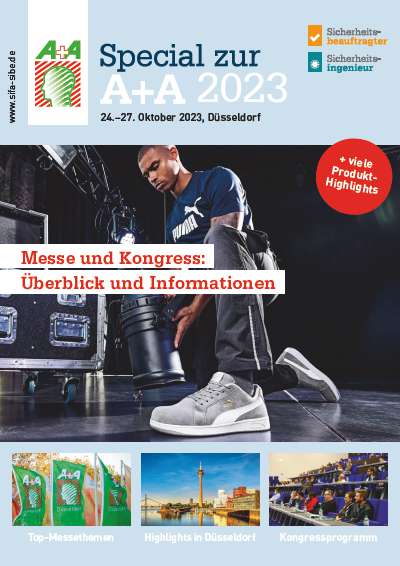Im letzten Heft (Sicherheitsingenieur 5/2019) ging es um die – personenbezogenen – Schranken bei Sanktionen wegen fehlender CE-Kennzeichnung: Aufsichtsbehörden können nur vom Hersteller die Erfüllung des Produktsicherheitsrechts erzwingen, nicht vom Betreiber. In diesem Beitrag wird begründet, dass auch – sachlich – die Handlungsmöglichkeiten begrenzt sind: Eine Stilllegung beim Betreiber
Unsere Webinar-Empfehlung
Es gibt viele Fälle, in denen die Fallhöhe für eine herkömmliche Absturzsicherung nicht ausreicht. Beispiele für Arbeiten in geringer Höhe sind z.B. der Auf- und Abbau von Gerüsten, die Wartung von Industrieanlagen und Arbeiten in Verladehallen sowie Anwendungen in der Bahn und…
Teilen:










 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!