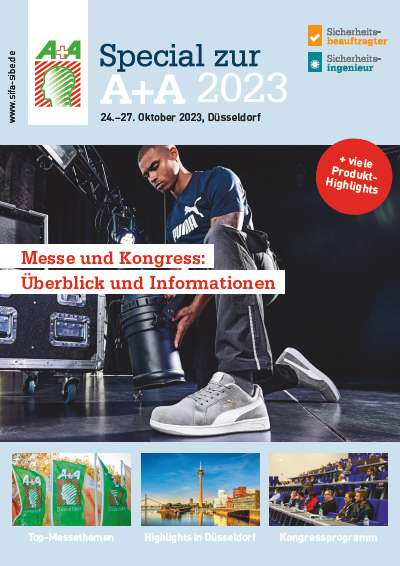Der Unternehmer und seine Verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) – diese Formulierung deutet eine besondere Beziehung an, und das ist sie auch. Klar ist: Beide sind aufeinander angewiesen. Hat ein Unternehmen einen elektrotechnischen Betriebsteil und hat der Unternehmer keine entsprechende Ausbildung, braucht er eine VEFK, die es wiederum ohne den Unternehmer
Unsere Webinar-Empfehlung
22.02.24 | 10:00 Uhr | Das Bewusstsein für die Risiken von Suchtmitteln am Arbeitsplatz wird geschärft, der Umgang mit Suchtmitteln im Betrieb wird reflektiert, sodass eine informierte Entscheidung über Maßnahmen zur Prävention von und Intervention bei Suchtmittelkonsum am Arbeitsplatz…
Teilen:










 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!