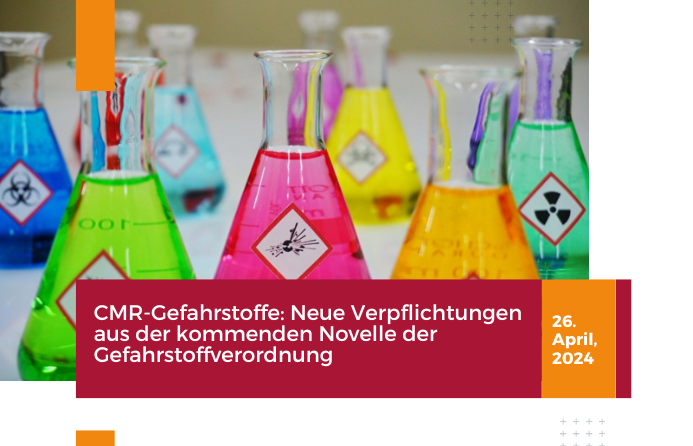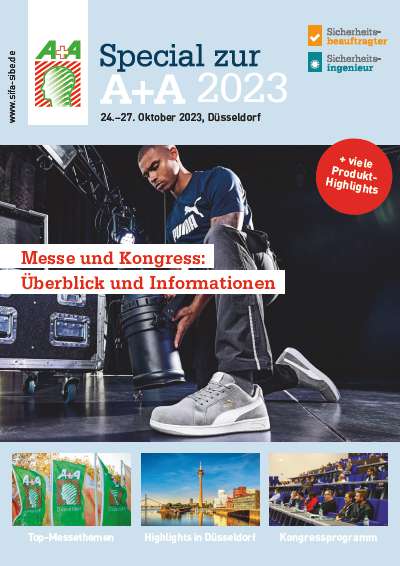Was als Probebetrieb deklariert wird, kann schon (längst) bestimmungsgemäße Verwendung sein! Im Anschluss an Teil 1 in Sicherheitsingenieur 7/2020 (hier der Link) werden die herausgearbeiteten Rechtsgrundsätze für (eher selten) mögliche rechtliche Gestaltungsspielräume bei der Gewährleistung eines ausreichend sicheren Probebetrieb an einem Gerichtsurteil aus NRW zu einer Regressklage der
Unsere Webinar-Empfehlung
CMR-Gefahrstoffe der Kat. 1A oder 1B stellen unter den Gefahrstoffen die höchste Gesundheitsgefahr dar, weshalb die Gefahrstoffverordnung in § 10 besondere Schutzmaßnahmen für diese Stoffe vorschreibt.
Teilen:










 SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!
SifaPlus-Beiträge und das große Archiv erhalten!